Das Äußere der Kirche
Egal, aus welcher Himmelsrichtung man Pretzschendorf erreicht – die Kirche fällt stets ins Auge. Durch ihre Größe und ihren Standort auf der Anhöhe in Richtung Freiberg ist sie selbst aus einigen Kilometern Entfernung als Wahrzeichen von Pretzschendorf zu erkennen. Bei der letzten Sanierung der Kirchenfassade in den Jahren 1999 bis 2001 erhielt die Kirche einen weißen Anstrich. Erstmals wurden die Fensterfaschen und Mauerkanten aus Sandstein mit verputzt und hellgelb angestrichen, sodass sich die helle barocke Farbgebung des Innenraums seitdem außen widerspiegelt.
Das Hauptportal der Kirche befindet sich im Turm, der auf der Nordwestseite des Kirchenschiffs angeordnet ist. Dieses erstreckt sich symmetrisch zu beiden Seiten des Turms und wird von kleinen Anbauten mit Seiteneingängen abgeschlossen, über die auch die drei Emporen erreicht werden können.
Der Ausbau in halber Höhe des Turmes (Nordostseite) ist 1933 für den Posaunenchor geschaffen worden. Von dort aus wird in jeder Silvesternacht geblasen, bevor die Glocken das neue Jahr einläuten.
Weithin sichtbar erhebt sich über der Zwiebel des Turmes der im Jahre 1999 zum siebten Mal vergoldete Turmknopf. Im Inneren dieses 80 mal 90 Zentimeter großen ovalen Knopfes befinden sich drei verlötete Kupferkassetten mit den sogenannten „Turmknopfnachrichten“. Diese handgeschriebenen Berichte bringen eine Fülle von Mitteilungen aus der Geschichte der Kirchgemeinde.
Über dem Turmknopf dreht sich in einer Höhe von fast 50 Metern die Wetterfahne aus dem Jahre 1816 mit der vergoldeten Jahreszahl 1734.
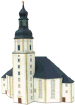
Das Kircheninnere
Besonderheiten
Der innere Aufbau der Kirche entspricht den von George Bähr geschaffenen Gotteshäusern. So wie in der Dresdner Frauenkirche, dem bekanntesten Werk dieses genialen Baumeisters der Barockzeit, sind auch hier Altar, Kanzel und Orgel übereinander angeordnet. George Bähr und Christian Simon, der den Bau der Pretzschendorfer Kirche geleitet hat, haben mehrfach zusammengearbeitet. Ob auch beim Bau der Pretzschendorfer Kirche eine solche Zusammenarbeit zustande gekommen ist, lässt sich jedoch nicht belegen.
Interessant sind die beiden Beichtstühle unter den bunten Glasfenstern. Es gibt nur wenige Beispiele dafür, dass auch in evangelischen Kirchen einst Beichtstühle eingebaut worden sind.
Links neben der Orgel hängt ein altes Kruzifix. Das lateinische Wort „crucifixus“ bedeutet „ans Kreuz geheftet“. Wie die sogenannte Feuerglocke in der Laterne des Kirchturmes stammt auch dieses Kruzifix noch aus der alten Kirche. Der unbekannte Künstler hat es meisterhaft verstanden, die Züge des Leidens auf dem Gesicht des Gekreuzigten darzustellen. Eine Besonderheit dieses Kunstwerkes ist es, dass die Haare nicht aus Holz geschnitzt sind. Sie wurden als Haarperücke aufgesetzt. Auch im Freiberger Dom gibt es drei Beispiele für eine derartige Gestaltung des Haares.
Erntedankfest in der Pretzschendorfer Kirche
Ein besonderer Höhepunkt in jedem Jahr ist die Feier des Erntedankfestes, wenn sich die Kirche wie zu Weihnachten bis zur obersten Empore füllt. Viele Gemeindemitglieder schmücken mit Blumenkränzen die Emporen und mit Früchten aus Feld und Garten sind der Taufstein und der Altar reich dekoriert. Der Gottesdienst beginnt mit dem Einmarsch des Posaunenchors, der das Pretzschendorfer Erntedankfestlied spielt. Anschließend bringen die Kinder und Vorkonfirmanden ihre Erntegaben zum Altar.
besonderer Höhepunkt in jedem Jahr ist die Feier des Erntedankfestes, wenn sich die Kirche wie zu Weihnachten bis zur obersten Empore füllt. Viele Gemeindemitglieder schmücken mit Blumenkränzen die Emporen und mit Früchten aus Feld und Garten sind der Taufstein und der Altar reich dekoriert. Der Gottesdienst beginnt mit dem Einmarsch des Posaunenchors, der das Pretzschendorfer Erntedankfestlied spielt. Anschließend bringen die Kinder und Vorkonfirmanden ihre Erntegaben zum Altar.
Das Erntedankfest findet traditionell am dritten Sonntag im September um 14 Uhr statt. Der nächste Termin ist damit voraussichtlich der 20. September 2026.
Unser altes Pretzschendorfer Erntedankfestlied
|
|
|
|
|
Kirchenbau 1732 – 1734
Die alte Pretzschendorfer Kirche stand in der Mitte des Friedhofes. Ihre Grundmauern sind heute noch im Erdreich vorhanden.
Diese alte Kirche wurde zu klein. Bereits um 1690 dachte man daran, eine neue Kirche zu errichten. Ein Neubau der Kirche musste jedoch lange hinausgeschoben werden. Die verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges waren noch nicht überwunden. Die Pest hatte 1680 in den drei zur Kirchgemeinde gehörenden Dörfern Pretzschendorf, Röthenbach und Friedersdorf 200 Menschen dahingerafft.
Schlechte Ernten und Teuerung trugen dazu bei, dass die Gemeinde sich nur langsam erholen konnte. So wurde der Wunsch nach einer neuen, größeren und helleren Kirche weitergegeben an Kinder und Enkel. Es vergingen Jahrzehnte.
Im Winter 1731 wird es gewesen sein, als wieder einmal über die Enge und Dunkelheit der Kirche gesprochen wurde. Und wieder hieß es: Wir sind zu arm! Wir schaffen’s nicht! Da habe sich einer zu Wort gemeldet und gesagt: Wenn wir es wieder so machen wie unsere Großväter, wenn wir den Bau einer neuen Kirche auf die Enkel abschieben, dann wird es wohl nie werden. Wie wäre es denn, wenn wir im Vertrauen auf Gottes Hilfe einfach anfingen? Und wenn jeder zupackt, dann müsste es doch möglich sein, dass wir uns eine neue Kirche bauen.
Dieser Vorschlag fand Zustimmung. Die gesamte Gemeinde wurde aufgerufen zur Hilfe und Mitarbeit. Und viele waren dazu bereit. Auch die wurden mitgerissen, „welche vielleicht nicht aus böser Meinung, sondern aus Furchtsamkeit und wegen der unüberwindlich anscheinenden Schwierigkeiten“ (Chronik von Pretzschendorf) gegen diesen Bau gestimmt hatten.
Da man eine Kirche bauen wollte, die nicht wieder zu klein werden sollte, musste ein tiefes Fundament gegraben werden. Bei den Ausschachtungsarbeiten stieß man aber sehr schnell auf festes Gestein. Damit hatte man nicht gerechnet. Dieser feste Grund war eine große Erleichterung für die weitere Arbeit. Und für die Gemeinde war es eine Freude zu wissen: unsere neue Kirche steht auf Felsengrund.
Am 5. Mai 1732 konnte der Grundstein gelegt werden. Mit großem Eifer wurde die Arbeit begonnen. In dem Bericht über den Kirchenbau, der 1734 in den Turmknopf gelegt worden ist, weist Pfarrer Gütner hin auf die vielen Helfer, die unermüdlich dazu beigetragen haben, dass die Arbeit nicht ins Stocken kam. Er erwähnte auch, „dass diejenigen, die im Anfange sich noch am schwierigsten dazu bezeiget, hernach die vornehmsten Beförderer dieses Kirchenbaues geworden, und dazu nach allem Vermögen Rat und Tat gegeben haben.“
Erstaunlich war auch die Bereitschaft, durch finanzielle Opfer den Bau einer so großen Kirche zu ermöglichen. Pfarrer Gütner schreibt in dem bereits genannten Bericht darüber: „Doch war dieses noch lange nicht zulänglich, das vorhabende Werk auszuführen, sondern die gutwilligen Gaben und Geschenke, zu welchen Gott die Herzen ganz wunderbarerweise lenkte, mussten der Sache noch den besten Ausschlag geben. Denn nicht nur die hochadligen Herren Collatores, sondern auch alle und jeder in der ganzen Kirchfahrt freiwillig und ungezwungen zu diesem Kirchbau solche Verehrung getan, als man sich’s vorher kaum vermutet hätte. Auch junge und ledige Leute männlichen und weiblichen Geschlechts samt vielen Dienstboten ließen sich vom Geist Gottes regieren und brachten dazu ihre Gaben nach ihrem Vermögen. Auch von fremden und entlegenen Orten dazu ist erbeten oder ungebeten gespendet und geschenkt worden, nicht weniger was auch durch freiwillige Sammlungen bei Verlöbnissen, Hochzeiten, Kindtaufen und sonsten reichlich zusammen gebracht worden ist. Also dass man in der Wahrheit sagen und behaupten kann, dass der ganze neue Kirchen- und Turmbau, so mit Kanzel und Altar über 6000 Thaler kostet, größtenteils durch freiwillige Gaben, Geschenke und Almosen, dazu Gott die Herzen regiert hat, zustande gekommen ist.“
Dank dieser erstaunlichen Unterstützung des Unternehmens durch die Gemeinde wurde es möglich, den Bau der Kirche und der unteren 4 Stockwerke des Turmes in anderthalb Jahren – in den zwei Sommern 1731/32 – zu vollenden.
Eine derart kurze Bauzeit war für die damaligen Verhältnisse eine enorme Leistung. Es musste ja alles mit der Hand gemacht werden. Ein Beispiel für diese Handarbeit ist das auch heute noch jeden Fachmann beeindruckende Dachgebälk. Die Balken wurden mit der Hand behauen. Sie sind ohne einen einzigen eisernen Nagel ineinandergefügt worden.
Im Jahre 1734 wurde die alte Kirche abgebrochen. Die Reste der Grundmauern sind noch heute im Erdreich vorhanden. In besonders trockenen Jahren sind sie vom Balkon des Kirchturmes aus an den vertrockneten Rasenstreifen zu erkennen.
Mit den Steinen, Brettern und Balken der alten Kirche wurde der Turm vom 4. Stockwerk an weitergebaut. Auf einigen dieser Bretter und Balken sind heute noch alte verschnörkelte Ornamente – Fachleute sprechen vom Motiv des „rollenden Hundes“ – zu erkennen. Auch von außen war bis zur Sanierung im Jahr 2000 am Turm ablesbar, von welcher Höhe an 1734 weitergebaut worden ist. Die Eckquader aus Sandstein sind in der unteren Hälfte des Turmes unregelmäßig in ihrer Länge und Breite. Im oberen Teil des Turmes dagegen sahen wir nur regelmäßig behauene Ecksteine. An der Ostseite des Turmes befindet sich eine Sandsteinplatte mit den fünf Jahreszahlen 1783 – 1833 – 1883 – 1933 – 2000. Diese Zahlen sind ein Hinweis auf jene Jahre, in denen die Kirche einen neuen Außenputz erhielt.
Über die Kosten des gesamten Kirchenbaus in den Jahren 1732/33 gibt die Chronik Auskunft. Die Ausgaben beliefen sich auf „6.843 Thaler 15 Groschen 9 Pfennige“. Dies ist eine erstaunlich niedrige Summe der Ausgaben für den Bau einer so großen Kirche! In der Chronik heißt es dazu: „Es ist zu verwundern, mit welch geringem Geldbetrag der große Bau bewältigt worden ist.“
Es ist auch viel Material für den Kirchenbau geschenkt worden. Das gilt vor allem für die Steine und das Zimmerholz. Allein aus Röthenbach wurden 54 Stämme Zimmerholz unentgeltlich zur Verfügung gestellt! Ein weiterer Grund für die überraschend niedrige Endsumme der Ausgaben ist die große Zahl der freiwillig geleisteten Arbeitsstunden, für die kein Lohn verlangt wurde.
Quelle: Festschrift „250 Jahre Kirche zu Pretzschendorf“
Sanierung und Restaurierung 1999 – 2007
Von 1999 bis 2001 wurde das Äußere der Pretzschendorfer Kirche umfassend saniert. Die Erneuerungsarbeiten begannen am Kirchturm mit der Abnahme der Turmkugel und der Wetterfahne am 17. Juni 1999. Am 23. Oktober des Jahres konnte der Kirchturm mit neu vergoldeter Fahne und Kugel gekrönt werden, nachdem die Neueindeckung des Daches abgeschlossen war. Im Jahr 2000 folgte die Fertigstellung des gesamten Kirchturms, der neuen Putz, neue Türen und neue Fenster erhielt. Im darauffolgenden Jahr wurde schließlich die Erneuerung der Außenfassade vollendet – die Kirche erstrahlt seitdem in weiß und gelb.
Im Jahr 2007 folgte die Restaurierung des Kircheninneren. Der gesamte Innenraum wurde Anfang des Jahres erstmals in der Kirchengeschichte vollständig eingerüstet, sodass die Decke von der obersten Rüstebene aus berührt werden konnte. Altar und Kanzel, Kruzifix, Bänke, Emporen und die Orgel wurden gereinigt und restauriert, die Wände erhielten einen neuen Anstrich. Auch die Decke wurde neu verfugt und malerisch instand gesetzt. Das Erntedankfest konnte als erster Gottesdienst in der restaurierten Kirche gefeiert werden, deren barocke Schönheit nun wieder voll zur Geltung kommt.
Die Pretzschendorfer Glocken
Die kleine Taufglocke, 1627 bei Hilliger in Freiberg gegossen, hing schon in der alten Kirche und hat die Zeiten überdauert. Zu Taufen erklingt sie aus der Laterne oben auf dem Kirchturm. Das aus drei Glocken bestehende Geläut in der Glockenstube hingegen hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich:
       
|
Im Jahre 1900 ließ die Kirchgemeinde bei Bierling in Dresden ein vollständiges neues Dreiergeläut aus Bronze gießen. Wie es zu dieser Zeit in Mode war, erfolgte der Einbau eines neuen Glockenstuhls aus Stahl anstelle des hölzernen. Am 3. April 1900 konnten die neuen Glocken in einem feierlichen Festzug mit Pferdewagen von Colmnitz nach Pretzschendorf gebracht und auf den Turm gezogen werden. Nach nur 17 Jahren mussten die mittlere und die kleine Glocke bereits wieder herunter – die Rüstungsproduktion im Ersten Weltkrieg forderte die Bronze. Die große Glocke blieb aufgrund ihres wertvollen Äußeren und des besonderen Klangs verschont. Nach dem Kriegsende 1918 stellte die Kirchgemeinde Nachforschungen an, ob die abgelieferten Pretzschendorfer Glocken vielleicht noch nicht eingeschmolzen worden waren. Da bis 1920 jedoch kein Erfolg eintrat, musste man sich um neue Glocken kümmern. Eine neue mittlere Glocke wurde bei Bierling gegossen, eine kleine Bierling-Bronzeglocke konnte von der Kirchgemeinde Colmnitz erworben werden. So war das Bronzegeläut 1922 wieder komplett. Diesmal währte es 20 Jahre, bis der nächste Krieg die Glocken verschlang: Im April 1942 mussten alle drei Glocken abgenommen und für die Rüstungsindustrie des Zweiten Weltkriegs bereitgestellt werden. Der Kirchenvorstand folgte der Empfehlung des Landeskirchenamtes, vor der Abnahme Tonaufnahmen der einzelnen Glocken und des gesamten Geläuts auf Schellackplatten anzufertigen. Diese Platten, die bis heute erhalten geblieben sind, dienten in den nachfolgenden Gottesdiensten als Glockenersatz: Mit einem Plattenspieler hinter dem Altar wurde das Läuten abgespielt. Als der Krieg 1945 endlich ein Ende hatte, begannen wieder die Nachforschungen: Sind die Pretzschendorfer Glocken unter den etwa 15.000 auf dem Hamburger „Glockenfriedhof“, dem Lager der noch nicht eingeschmolzenen Glocken? 1946 bekam man die Mitteilung, dass dies nicht der Fall sei. So begannen trotz sehr schwerer Zeiten Bemühungen um ein neues Geläut. Geld- und Eisenspenden wurden gesammelt und viel organisatorisches Geschick war notwendig, bis im Herbst 1948 endlich in Morgenröthe-Rautenkranz bei Schilling & Lattermann drei Glocken aus Eisenhartguss, auch als „Klangstahl“ bezeichnet, abgeholt werden konnten. Im Vergleich zu tongleichen Bronzeglocken, für die weder Material noch Geld vorhanden war, sind Eisenhartgussglocken größer und schwerer und ihre mögliche Nutzungsdauer liegt deutlich unter 100 Jahren. Trotzdem waren die Pretzschendorfer froh, als zum Kirchweihfest 1948 endlich wieder ein richtiges Geläut erklang und der Plattenspieler nicht mehr als Ersatz dienen musste. Nach dem Ende der DDR konnten immer mehr Kirchgemeinden in Sachsen ihre Eisenhartguss- oder Stahlglocken durch neue Bronzeglocken ersetzen. Da den Eisenhartgussglocken nur eine Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren zugeschrieben wurde, begannen 2009 auch in Pretzschendorf konkrete Überlegungen zu einem neuen Bronzegeläut. Der Posaunenchor stellte die erste Spende dafür bereit, weitere Beiträge aus nah und fern folgten. Im Dezember 2016 wurde in der Kunst- und Glockengießerei Lauchhammer die kleine Glocke gegossen; die mittlere und die große folgten im Januar 2017. Die mittlere Glocke bestand jedoch die Klangprüfung nicht, sodass im August ein erneuter Guss notwendig war – dieser gelang. Am 7. April 2018 läuteten die alten Glocken zum letzten Mal. Sie wurden am 19. April mit einem großen Kran vom Turm gehoben und bekamen einen Ehrenplatz auf dem Friedhof. |
Glockendaten
| Guss- jahr |
Ab- nahme |
Material | Masse ca. |
Durchmesser unten |
Inschriften | |
| Taufglocke | ||||||
| 1627 | - | Bronze | 200 kg | 700 mm | Caspar Fleischer hat 10 Gilten zu solcher Glocken vorehret 1727. HANS DITTERICH von HAR(T)ITSCH AVF BRETZSCHENTORF | |
| Geläut 1900 | ||||||
| 1900 | 1917 | Bronze | ? | ? | Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung | |
| 1900 | 1917 | Bronze | ? | ? | Die Liebe höret nimmer auf | |
| 1900 | 1942 | Bronze | ? | 1600 mm | Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben. Gestiftet von Traugott Leberecht Richter, Gutsauszügler in Friedersdorf, zu seinem 73. Geburtstage am 7. Juli 1899! Ehre sei Gott in der Höhe! | |
| Geläut 1922 | ||||||
| 1900 | 1942 | Bronze | ? | 1050 mm | SEID FLEIẞIG ZU HALTEN DIE EINIGKEIT IM GEISTE DURCH DAS BAND DES FRIEDENS. Den Menschen Gottes Wohlgefallen. | |
| 1922 | 1942 | Bronze | ? | 1250 mm | Nach schwerer Kriegszeit von der Kirchfahrt im Jahre 1921 gestiftet. Heldenglocke, zum Dank gegen alle, die für das Vaterland kämpften, zum Gedächtnis der Gebliebenen. Die Liebe höret nimmer auf | |
| 1900 | 1942 | Bronze | ? | 1600 mm | Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben. Gestiftet von Traugott Leberecht Richter, Gutsauszügler in Friedersdorf, zu seinem 73. Geburtstage am 7. Juli 1899! Ehre sei Gott in der Höhe! | |
| Geläut 1948 | ||||||
| 1948 | 2018 | Eisenhartguss | 689 kg | 1147 mm | DEN MENSCHEN GOTTES WOHLGEFALLEN. ICH WILL SINGEN VON DER GNADE DES HERRN EWIGLICH | |
| 1948 | 2018 | Eisenhartguss | 1157 kg | 1380 mm | FRIEDE AUF ERDEN. SEI GETREU BIS IN DEN TOD, SO WILL ICH DIR DIE KRONE DES LEBENS GEBEN. | |
| 1948 | 2018 | Eisenhartguss | 2338 kg | 1762 mm | EHRE SEI GOTT IN DER HÖHE. IHR SOLLT ERFAHREN, DAẞ ICH DER HERR BIN | |
| Geläut 2018 | ||||||
| 2016 | - | Bronze | 417 kg | 880 mm | OH LAND, LAND, LAND HÖRE DES HERRN WORT | |
| 2017 | - | Bronze | 748 kg | 1050 mm | UNSER TÄGLICH BROT GIB UNS HEUTE | |
| 2017 | - | Bronze | 1184 kg | 1260 mm | JESUS SPRICHT: ICH LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN | |
Quellen: Geschichte der Pretzschendorfer Glocken (2018); Glocken in Sachsen (2011)

































































